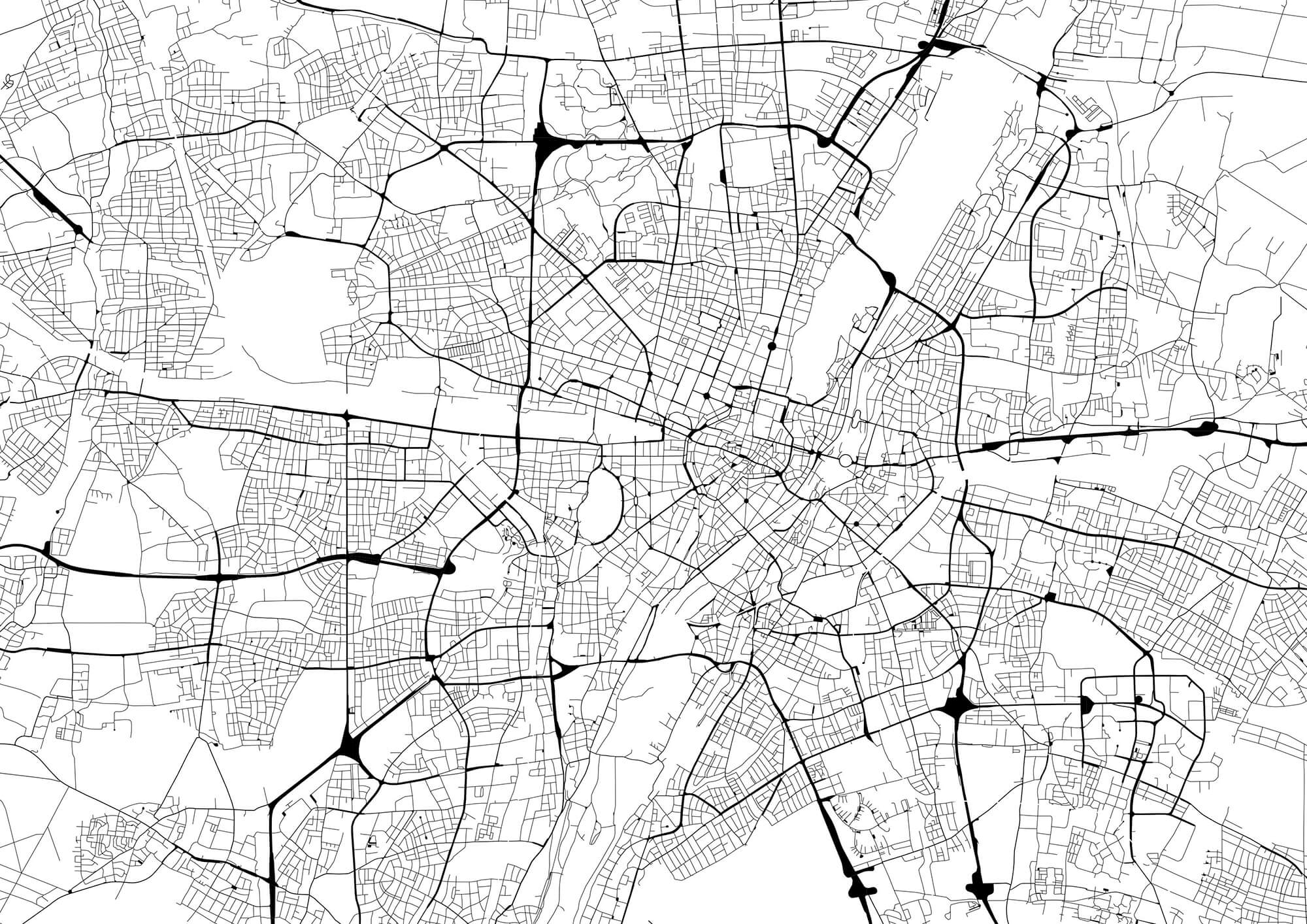Städtebau & Quartiersentwicklung
Stadtentwicklung für kulturelle Vielfalt: Vernetztes Quartier, gemischte Stadt
Text: Felicitas Hillmann & Dr. Kai Unzicker | Foto (Header): © JFL PHOTOGRAPHY – stock.adobe.com
Für eine weitsichtige Stadtentwicklungsplanung braucht es einen Wohnungsmarkt, der sozialen Verwerfungen entgegenarbeitet, um Menschen unabhängig von ihrem sozialen oder kulturellen Hintergrund stärker miteinander in Verbindung zu bringen. Aber auch bestimmte Einrichtungen und Orte in einem Stadtteil können den Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt fördern.
Auszug aus:
QUARTIER
Ausgabe 1.2020
Jetzt abonnieren
Diese Ausgabe als Einzelheft bestellen
Wo sich das Stadtteilmuseum von Friedrichshain-Kreuzberg befindet? Das weiß so gut wie jeder in dem südöstlich der Berliner Mitte gelegenen Bezirk, haben Studierende des Instituts für Stadt- und Regionalplanung der TU Berlin vor einiger Zeit herausgefunden. In einem Seminar zur Stadtentwicklung haben sie sich mit der Rolle des Museums für den Stadtteil beschäftigt. Ihre Erkenntnis: Das Friedrichshain-Kreuzberg-Museum – kurz „FHXB“ –, ein roter Klinkerbau in der Adalbertstraße, ist ein lebendiger Ort, der Vernetzung und Nachbarschaftlichkeit voranbringt. Das lässt nicht nur die Biertischgarnitur vor der Tür vermuten. Das Haus versteht sich als Heimatmuseum neuen Typs, es hat sich geöffnet für die Menschen, die hier leben, Junge wie Alte, Zugewanderte wie Alteingesessene, und erzählt mit ihnen die vielfältigen Geschichten des Stadtteils.
Mit Aktionen wie dem Museumslabor ist das „FHXB“ ein Ort von und für die Bewohner von Kreuzberg-Friedrichshain geworden, der ihre Vielfalt spiegelt und dieser einen eigenen Wert gibt. Friedrichshain-Kreuzberg, ehemals durch die Mauer durchtrennt, ist heute der von der Fläche her kleinste Berliner Bezirk mit der zugleich höchsten Bevölkerungsdichte und dem geringsten Durchschnittsalter. Einerseits als alternatives Szene- und Ausgehviertel beliebt, spiegelt der Bezirk auf der anderen Seite ein Brüchigwerden gewachsener sozialer Verbindungslinien wider und einen tiefgreifenden Wandel, der sich heute in vielen Großstädten beobachten lässt: Migration, Flucht und eine insgesamt wachsende gesellschaftliche Mobilität haben dazu geführt, dass die Bevölkerung zunehmend divers und immer weniger sesshaft ist. Zugleich wächst die soziale Ungleichheit und führt zu neuen Verdrängungsbewegungen [1]. Ist der gesellschaftliche Zusammenhalt angesichts solcher Tendenzen in Gefahr? Das gesamtdeutsche Meinungsbild zumindest weist darauf hin:
Laut einer Befragung des Instituts für Demoskopie Allensbach waren im letzten Jahr 67 % der Deutschen der Meinung, der Zusammenhalt sei zurückgegangen. Dies sind elf Prozentpunkte mehr als noch 2016. Und auch das „Radar Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass drei von vier Deutschen den Zusammenhalt als gefährdet ansehen. Zunehmender Populismus, die Verrohung der Debattenkultur oder die divergierenden Werthaltungen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen bis hin zum Eliten-Bashing bestärken dieses mulmige Gefühl.
Verschiedene Milieus begegnen sich seltener
Zugleich schreitet die soziale Segregation der Gesellschaft fort: Nicht nur verdrängen teure Mieten ärmere Bewohner, wohlhabende Eltern suchen auch nach vermeintlich besseren und oftmals kulturell homogeneren Schulen oder finanzieren ihren Kindern die Eigentumswohnung zum Studium. Die verschiedenen Bildungs- und Einkommensgruppen oder auch die kulturellen Milieus begegnen sich im Alltag, am Arbeitsplatz und in der Freizeit immer seltener. Wer sich aber nicht begegnet, erfährt auch nichts voneinander und wird sich nach und nach fremder. „Wer nicht mithalten kann, soll auch nicht mitmachen können“, so könnte man den Subtext der Stadtentwicklungspraxis der letzten Jahre lesen, quasi einem Gegenprogramm zum Leitbild der gemischten Stadt.
Inwiefern wird diese Erfahrung gerade auch in den Städten greifbar, die heute – im Vergleich zu ländlichen und kleinstädtischen Regionen – als Laboratorien des Umgangs mit der wachsenden gesellschaftlichen Vielfalt gelten können? In der Dichte des urbanen Zusammenlebens ist zwar einerseits die soziale Spaltung besonders gut sichtbar und erlebbar – und kulturelle Segregation kann hier zu einem Problem werden, wenn eine weitsichtige Stadtentwicklungsplanung dem nicht vorbeugt. Andererseits gibt es keine besseren Orte als Kreuzberg-Friedrichshain und andere multikulturelle innerstädtische Viertel, um unterschiedliche Weltsichten kennenzulernen und Wege eines friedlichen, womöglich sogar schöpferischen Umgangs miteinander einzuüben. Kontakt führt nicht zwangsläufig zu Austausch, aber ohne ihn sind die Chancen dafür, Gemeinsamkeiten auf die Spur zu kommen, praktisch nicht mehr vorhanden.
Die Erfahrungen jener urbanen Laboratorien zeigen: Die entscheidenden Lösungen für die großen sozialen Verwerfungen, die wir aktuell erleben, liegen auch im Lokalen und können nicht von heute auf morgen umgesetzt werden. Will man die Menschen ganz unabhängig von ihrem sozialen, kulturellen oder auch religiösen Hintergrund stärker miteinander in Verbindung bringen, dann braucht es einen Wohnungsmarkt und eine Wohnungsbaupolitik, die sozialen Verwerfungen entgegenarbeitet. Es ist aber auch an der Zeit, öffentliche Räume neu zu entdecken, sie zu öffnen und dafür zu sorgen, dass die Menschen sie sich aneignen können.
Wir müssen das schaffen, was wir in der Studie „Kulturelle Vielfalt in Städten: Fakten – Positionen – Strategien“ produktive Orte der kulturellen und migrationsbedingten Vielfalt genannt haben ([2], S. 99 – 110). Das Zusammenleben in Vielfalt wird eben nicht nur „von oben“ programmatisch gefördert, sei es durch Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung, Antidiskriminierungsprogrammatiken oder runde Tische, sondern auch auf der Straße, den Plätzen und öffentlichen Orten. Dort können Räume für Austausch und Miteinander entstehen.
In einigen Fällen kommt die Entwicklung allein aus der Bevölkerung, wenn die Zivilgesellschaft Brachflächen oder unattraktiv gewordene Versorgungsinfrastrukturen nutzt und sich (wieder) aneignet. Der Anstoß kann aber auch von Politik, Verwaltung bzw. Stadtplanung kommen: Aus beinahe vergessenen Bibliotheken können so lebendige Stadtteilzentren werden und aus Museen öffentliche Foren der gesellschaftlichen Selbstverständigung. In den meisten Städten lassen sich diese Orte finden, an denen aus der Zusammenarbeit innerhalb und mit der Zivilgesellschaft aus bestehender Infrastruktur ein neues gemeinsames Projekt entsteht. Diese Aktivitäten können ein Ausgangspunkt für umfassendere Stadtentwicklung sein.
Will man die Menschen ganz unabhängig von ihrem sozialen, kulturellen oder auch religiösen Hintergrund stärker miteinander in Verbindung bringen, muss es möglich sein, öffentliche Räume neu zu entdecken, sie zu öffnen und dafür zu sorgen, dass die Menschen sie sich aneignen können.
FOTO: FELICITAS HILLMANN
Getrennte Lebenswelten – gemeinsame Orte
Städte sind in sich divers: Unterschiedliche soziale, ökonomische, kulturelle oder ethnische Bevölkerungsteile leben in unterschiedlichen Kombinationen und Überschneidungen zusammen. Trotz dieser inhärenten Diversität bleiben die Lebenswelten der verschiedenen Bevölkerungsgruppen zumeist getrennt. An einzelnen Knotenpunkten verschränken sich aber die Lebenswege: Auf Marktplätzen und Einkaufsstraßen oder an Bahnhöfen verschwimmt die Diversität der Stadt zu einer Einheit. Die Wahrscheinlichkeit, dass hieraus aber etwas Neues, Gemeinsames entsteht, ist jedoch erst einmal gering.
Produktive Orte werden sie erst, wenn sie zu „Möglichkeitsorten“ werden. Etwa wenn unterschiedliche Gruppen, z. B. migrantische Jugendliche, diese ohne eine kulturelle Vorstrukturierung, weder aus der Herkunfts- noch der Aufnahmeperspektive, zur Entfaltung eigener Aktivitäten nutzen. Etablierten Kulturinstitutionen gelingt es im Moment kaum, Jugendliche, insbesondere mit Migrationshintergrund, zu erreichen, auch der Freiwilligen Feuerwehr und den Vereinen fehlen die Jungen. Außerhalb der Institutionen, im lokalen Stadtraum, sind die Erfolgsaussichten deutlich größer (siehe auch [3], S. 12 ff.). Der Ausbruch der Kunst aus den Kulturinstitutionen verändert sowohl diese Institutionen als auch die jeweiligen Stadtgesellschaften. So bezog vor einigen Jahren die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ein neues Probendomizil in einem bremischen Brennpunkt-Stadtteil und inszeniert inzwischen mit Jugendlichen aus diesem Quartier „Stadtteilopern“.
Produktive Orte von Viel
Im Sommersemester 2018 sollten Studierende der TU Berlin solche produktiven Orte migrationsbedingter Vielfalt – wie das erwähnte „FHXB“ – ausfindig machen. Sie entdeckten einen Kinderspielplatz und eine internationale Schule, zwei Flüchtlingsunterkünfte, einen Thai-Markt im Park, ein Ramadan-Foodfestival, ein Cross-over-Restaurant, zwei Kulturclubs sowie zwei Initiativen der Verwaltung und des Quartiersmanagements. All diese Orte eint, dass hier das Machen im Vordergrund steht, gerne zunächst ohne Plan und mit viel WhatsApp. In der Tradition von Jane Jacobs weist uns heute der angloamerikanische Soziologe Richard Sennett zu Recht darauf hin, dass die Ethik der offenen Stadt in der Fähigkeit zur Selbstreparatur bestehen sollte. Greifbar wird das dort, wo sich Menschen öffentliche Räume zu Eigen machen und man sie machen lässt, im Bewusstsein, dass Zusammenleben einer gewissen Unübersichtlichkeit bedarf.
Dass gerade Museen hier eine besondere Rolle spielen, kommt nicht von ungefähr. Sie sind seit jeher die Institutionen, die einen prägenden Einfluss auf das gesellschaftliche Selbstverständnis haben. Die Auswahl von Objekten, ihre An- und Einordnung in einer Ausstellung sowie die Art und Weise der Präsentation transportieren ein Gesellschaftsbild und regen zu Diskussionen an. So kann es gelingen, dass Museen dazu beitragen, eine lokale Wir-Identität zu schaffen, die die jeweils unterschiedlichen kulturellen Gruppen, sozialen Hintergründe und Lebensstile inkludiert.
Bibliotheken als Lern- und Kontaktorte
Auch Bibliotheken bieten in der Regel gute Voraussetzungen für ein produktives Zusammenwirken einer vielfältigen Stadtgesellschaft. Im Rahmen einer internationalen Recherche guter Praxis für das Zusammenleben in Vielfalt hat die Bertelsmann Stiftung im Jahr 2018 u. a. Aktivitäten in Barcelona untersucht. Die dortige Stadtregierung hat die rund 40 städtischen Bibliotheken als strategische Instrumente zur Förderung des Miteinanders erkannt und weiterentwickelt. Sie sind heute lokale Treff- und Informationspunkte, die von den Bürgern der unterschiedlichen Stadtteile rege genutzt werden. Um die verschiedenen Einwanderergruppen gezielt ansprechen zu können, wurden Bücher und Zeitungen in den jeweiligen Herkunftssprachen ins Programm aufgenommen. Das Angebot wurde um Leseklubs, Sprachkurse und ein weites Kulturangebot erweitert, wozu auch Tanz- und Kochkurse, Workshops und Ausstellungen gehören ([4], S. 31). Ähnlich verhält es sich in Deutschland: Auch die Auswertung der Nutzungsdaten der Berliner Bibliotheken zeigt, dass diese inzwischen hauptsächlich als Lern- und Kontaktorte fungieren und überdurchschnittlich von jungen Frauen mit Migrationshintergrund besucht werden ([2], S. 102).
Die Studierenden des TU-Seminar kamen ins Gespräch mit institutionellen Kümmerern wie dem Quartiersmanagement. Ihr wichtigster Befund war, dass die Bewohner sich für ihren Kiez einsetzten und Vorbehalte nur durch gemeinsame Arbeit abgebaut wurden. Niedrigschwellige Kommunikation, Frühstücksrunden, Stadtfeste und regelmäßig tagende Gremien waren Teil der Arbeit im Stadtteil, doch auch stärker institutionalisierte Formen wie der „Quartiersrat“ oder der „Aktionsfonds“ trugen zum Gemeinschaftsgefühl bei – ebenso das Vorhandensein von migrantischen Ökonomien als Brücke in verschiedene Communities hinein [5]. Dennoch: Gerade die schwierigen Zielgruppen waren nur mit großem Aufwand zu erreichen, und die Problemursachen lagen außerhalb der Zuständigkeit des Quartiersmanagements.
Je niedrigschwelliger, desto besser
Wer heute etwas für den gesellschaftlichen Zusammenhalt tun möchte, sollte sich zunächst in seiner Umgebung umschauen, im eigenen Stadtviertel, in der eigenen Gemeinde, in der Moschee: Wo sind die Orte, die sich nutzen lassen und die man – meist mit wenig Aufwand – zu einem produktiven Ort des gesellschaftlichen, zwischenmenschlichen Austauschs verwandeln kann? Letztlich sind es wenige Dinge, die nötig sind, um Bildung, Engagement und Diskurs zu ermöglichen: Leicht zugängliche oder unbürokratisch zu buchende Treffpunkte, kostenloser Zugang zum Internet, gerne ein paar Getränke und jemanden, der die Verantwortung übernimmt und die unterschiedlichen Akteure vernetzt. Je niedrigschwelliger, desto besser.
Wichtig ist jedoch, eines im Blick zu halten: Produktive Orte zeichnen sich dadurch aus, dass sie Möglichkeiten für das Unerwartete, Überraschende und Neue schaffen, sie lassen sich nicht top-down durchplanen und in ihrer Entwicklung voraussehen. Politik und Verwaltung können die Rahmenbedingungen begünstigen, Gruppen einbinden und ermutigen und so die Voraussetzungen schaffen. Entscheidend ist aber, den Prozessen und Aktivitäten tatsächlich Raum zu geben und Veränderungen zuzulassen. Ein gutes Beispiel für dieses produktive Zusammenspiel von Verwaltung und Zivilgesellschaft bot die sogenannte „Flüchtlings- oder Migrationskrise“ der Jahre 2015 und folgende. Hier zwang der Handlungsdruck zu mehr Offenheit und Experimentierbereitschaft in der Kooperation von Verwaltung und Zivilgesellschaft. Selbstorganisation, Selbstverwaltung und eine gewisse „Narrenfreiheit“ sind Grundvoraussetzungen für die Entwicklung produktiver Orte. Aufgabe der hauptamtlichen Strukturen ist es, den öffentlichen Raum so zu gestalten, dass er dies zulässt.
Das eingangs erwähnte Friedrichshain-Kreuzberg-Museum ist ein gutes Beispiel für einen integrativen Ansatz im Umgang mit kultureller Vielfalt. Es hat trotz extrem schlechter finanzieller Ausstattung Erstaunliches auf die Beine gestellt und wurde mit der Zeit zum Referenzpunkt für einen ganzen Stadtteil. Glücklicherweise haben wir in Deutschland in der Fläche unzählige Stadtbüchereien, Museen, Theater, Volkshochschulen und Jugendtreffs. Sie bilden eine soziale Infrastruktur, die wir als Gesellschaft nutzen können, um der Polarisierung entgegenzuwirken, um wieder in Dialog miteinander zu treten und Zusammenhalt zu stärken. Die Politik ist gefordert, u. a. durch innovative Finanzierungsmöglichkeiten gezielt unterstützend und vor allem auch kontinuierlich zu wirken. Auch die Klein- und Mittelstädte könnten so ihre Heimatmuseen, Büchereien und Spielplätze zum Kristallisationspunkt von Öffentlichkeit und einem neuen sozialen Miteinander machen.
Quellen
[1] Hillmann, Felicitas/Bernt, Matthias/Calbet i Elias, Laura (2017): Von den Rändern her denken. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, 67. Jahrgang 48, S. 25 – 31.
[2] Bertelsmann Stiftung (2018a): Kulturelle Vielfalt in Städten: Fakten – Positionen – Strategien. Gütersloh. Bearbeitung: Felicitas Hillmann und Hendrikje Alpermann. Download unter www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/kulturelle-vielfalt-in-staedten (DOI: 10.11586/2018026)
[3] Kamm, Friederike/Merkel, Christine M./Spohn, Ulrike/Unzicker, Kai (2018): Einleitung: Ergebnisse und Empfehlungen. In: Bertelsmann Stiftung: Kunst in der Einwanderungsgesellschaft. Beiträge der Künste für das Zusammenleben in Vielfalt. S. 8 – 16. Gütersloh. Download unter www.bertelsmannstiftung.de/de/publikationen/publikation/did/kunst-inder-einwanderungsgesellschaft
[4] Bertelsmann Stiftung (2018b): Von der Welt lernen. Gute Praxis im Umgang mit kultureller Vielfalt. Gütersloh. Download unter: www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/von-der-welt-lernen
[5] Hillmann, Felicitas (2018): Migrantische Unternehmen als Teil städtischer Regenerierung. In: Emunds, Bernhard/Czingon, Claudia/Wolff, Michael (Hrsg.): Stadtluft macht reich/arm: Stadtentwicklung, soziale Ungleichheit und Raumgerechtigkeit. Marburg: Metropolis, S. 297 – 326.
Die Autoren
Prof. Dr. Felicitas Hillmann
Leitung der Abteilung „Regenerierung von Städten“ am Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung und Professorin mit dem Fachgebiet: Transformation und städtischer Raum im internationalen Kontext am Institut für Stadt- und Regionalplanung an der TU Berlin.
www.leibniz-irs.de
Dr. Kai Unzicker
Senior Project Manager im Programm „Lebendige Werte“ der Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, und dort verantwortlich für die Projekte „Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt“ und „Vielfalt leben – Gesellschaft gestalten“.
www.gesellschaftlicher-zusammenhalt.de